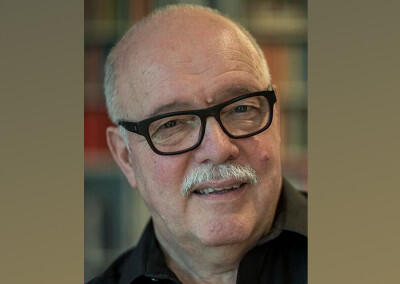Zentrale Server kennen keine Schweigepflicht
Neues vom Europäischen GesundheitsdatenraumEs ist still geworden um die elektronische Patientenakte (ePA), obwohl deren entscheidende Phase jetzt beginnt. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2024 informieren nämlich alle Krankenkassen ihre Versicherten über diese elektronische Patientenakte. An dem gigantischen Datensammelprojekt wurde seit 2003 gearbeitet, also mehr als zwanzig Jahre. Sieben Gesundheitsminister:innen waren und sind damit befasst, zwei von der FDP, zwei von der SPD und drei von der CDU.
Die letzten fünf Jahre, von 2019 bis 2024, hat Professor Ulrich Kelber (57) als Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit den Prozess der Fertigstellung und Veröffentlichung der ePA begleitet. Kurz bevor er von seiner eigenen Partei, der SPD, fallengelassen wurde und von der neuen Bundesregierung wegen seiner vielen kritischen Anmerkungen – nicht nur zu diesem Projekt – entlassen wurde, hat er dem Ärztlichen Nachrichtendienst noch ein Interview gegeben.
Darin beschreibt er, welchen Attacken er ausgesetzt war, als er auf datenschutzrechtlichen Minimalstandards beharrte. Die fehlenden Daten wegen übertriebenem Datenschutz machte man für den Tod von Hunderttausenden verantwortlich. Für diese griffige Propaganda blieb man bis heute aber jeden Beweis schuldig. Und alle anderen Länder in Europa würden mit dem Datenschutz viel pragmatischer umgehen als die ideologisch verbremsten und ängstlichen Deutschen.
Wenn Kelber sich aber mit Amtskolleg:innen traf, musste er feststellen, dass sie in anderen Ländern mit genau dem gleichen Satz unter Druck gesetzt wurden. Als die elektronische Patientenakte mit der Widerspruchslösung verknüpft wurde, äußerte Kelber Bedenken, dass das zu Misstrauen bei den Versicherten führen könnte. Er hielt die ePA zwar für enorm wichtig, kritisierte aber die mangelnden Steuerungsmöglichkeiten der Patient:innen bei Zugriffen. Er prangerte die nachträgliche Entfernung von Sicherheitsmaßnahmen bei der individuellen Verschlüsselung an.
Aus ärztlicher Sicht kommt zu all diesen schwerwiegenden Bedenken noch dazu, dass die Patientendaten nicht mehr da gelagert sein werden, wo sie entstanden sind, also in den Arztpraxen, sondern auf zentralen Servern. In einer Arztpraxis sind Daten vor Zugriffen geschützt. Sie unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Zentrale Server kennen aber keine Schweigepflicht. Ganz außerhalb unserer Kontrolle ist die Weitergabe aller Daten an den „Europäischen Gesundheitsdatenraum“. Mit diesen Millionen und Abermillionen Daten soll die Wissenschaft arbeiten, um unser aller Gesundheit zu verbessern. Was sind das für Daten, die in diesem Gesundheitsdatenraum landen? Daten aus Arztpraxen spiegeln weniger den tatsächlichen Gesundheitszustand als die tatsächliche Ausschöpfung aller Tricks im Umgang mit den Gebührenordnungen wider, bei denen man mit kleinen Veränderungen große Veränderungen des Einkommens generieren kann. Daten aus Krankenhäusern lassen auch ausreichende Evidenz vermissen, solange sie mit den Diagnosis Related Groups an die Vergütung geknüpft sind. Sie spiegeln nur die bestmögliche Bezahlung, nicht aber die bestmögliche Medizin wider. Ob die Sammlung solch großer Datenmengen wirklich dazu geeignet ist, etwas am Gesundheitszustand der Bevölkerung zu verbessern, darf bezweifelt werden.
Wenn man also davon ausgehen kann, dass es bei der elektronischen Patientenakte weniger um Gesundheit geht als um Daten, Daten, Daten, auf die die Versicherungskonzerne, die gesetzlichen und privaten Krankenkassen und Pharmafirmen Zugriff haben wollen, dann ist die Entlassung von Ulrich Kelber nur folgerichtig. Ein Störfaktor weniger! Vorgestern ist dann auch noch Susanne Ozegowski (41) in den „einstweiligen Ruhestand“ entlassen worden. Sie war als Abteilungsleiterin seit April 2022 für „Digitalisierung und Innovation“ im Bundesgesundheitsministerium als Digitalexpertin für die Einführung des E-Rezepts und der elektronischen Patientenakte verantwortlich. Noch Anfang des Jahres wurde sie von der Universität Dresden als „Digitalaffine Managerin des Jahres“ ausgezeichnet. Man darf gespannt sein, wessen Interessen sie geopfert werden musste.
Bernd Hontschik
Quelle: Frankfurter Rundschau
(mit freundlicher Genehmigung des Autors https://chirurg.hontschik.de/ )