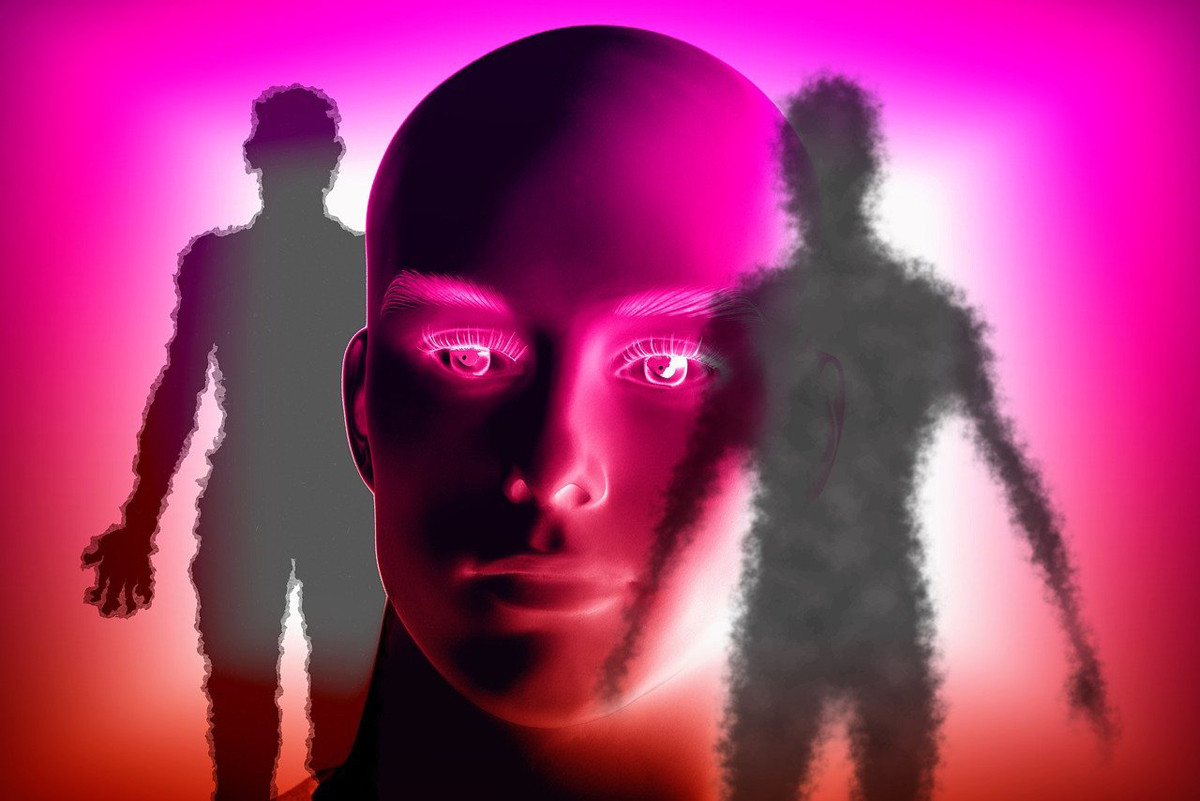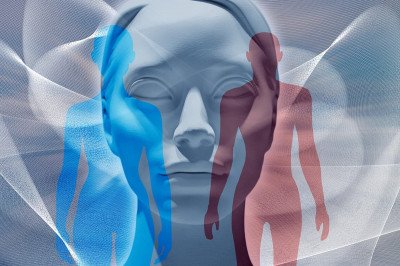Borderline – was hilft bei impulsiven bis depressiven Persönlichkeitsstörungen?
Unter der Bezeichnung „Borderline“ verstehen Psychotherapeuten eine Persönlichkeitsstörung. Die mentale Erkrankung zieht sich dabei über sehr lange Phasen hinweg, anstatt wie Depression episodisch vorzukommen, sagt Dr. med. Moritz de Greck, Leiter der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Typische Borderline-Symptome folgen dabei den gleichen extremen und verzerrenden Mustern der Wirklichkeitswahrnehmung und -bewertung wie andere Persönlichkeitsstörungen. Dazu zählen:
- Depression
- impulsives Auftreten
- selbstverletzende Handlungen
- Alkohol- und Drogenmissbrauch
- Psychische Dissoziationen bis hin zum Realitäts- und Erinnerungsverlust
Diese Anzeichen treten in unterschiedlicher Intensität auf. Außerdem müssen nicht zwingend alle Anzeichen vorhanden sein, damit die Diagnose Borderline vorliegt. Etwa vier von fünf Betroffenen erleben depressive Episoden, 15 Prozent weisen Essstörungen auf. Eine extreme Ordentlichkeit und Zwanghaftigkeit sowie ein extrem hohes Misstrauen gehören ebenfalls zum Borderline-Bild.
Wie äußern sich Borderline-Symptome?
Nach Erfahrungen von Moritz de Greck beschreiben Borderliner oft ein enorm tiefes Gefühl innerer Leere. Das Umfeld kann dies meist nicht verstehen oder nachfühlen. Zugleich zeigen sich Borderliner oft sehr angespannt. 80 Prozent der Betroffenen neigen dazu, sich in Momenten großer Überreizung selbst zu verletzen. Dies hilft ihnen kurzzeitig, die überbordenden Gefühle abzuführen und sich zu regulieren.
Ihr Selbstbild und ihr Bild von anderen Menschen sind emotionalen Schwankungen ausgesetzt. Eine große Zuneigung zu einer Person kann in kurzer Zeit zu innerem Abscheu umschwenken. In den intensiven Beziehungen mit Borderline-Betroffenen kann es oft zu heftigen Streitigkeiten und zu einem radikalen Kappen der Beziehung seitens der Borderline kommen.
Gleichzeitig leiden sie an Verlustängsten und der Angst vor Einsamkeit. Borderliner können sehr viel Energie und Mühe dafür aufbringen, einer Verlusterfahrung vorzubeugen oder sie zu unterbinden. Das führt meist zu äußerst instabilen Beziehungen, begleitet von großen Selbstzweifeln und Aggressivität.
Laut Dr. Sabine C. Herpertz, ärztlicher Direktorin der Klinik für Allgemeine Psychiatrie an der Universität Heidelberg, zeigen 80 Prozent der Borderliner mindestens einmal jährlich ein aggressiv auffälliges Verhalten. Die Selbstzweifel und Beschwerden können stark anwachsen. Viele Menschen mit der Persönlichkeitsstörung plagen Suizidgedanken. Mit knapp 10 Prozent liegt die tatsächliche Suizidrate in dieser Patiemntemgruppe sehr hoch.
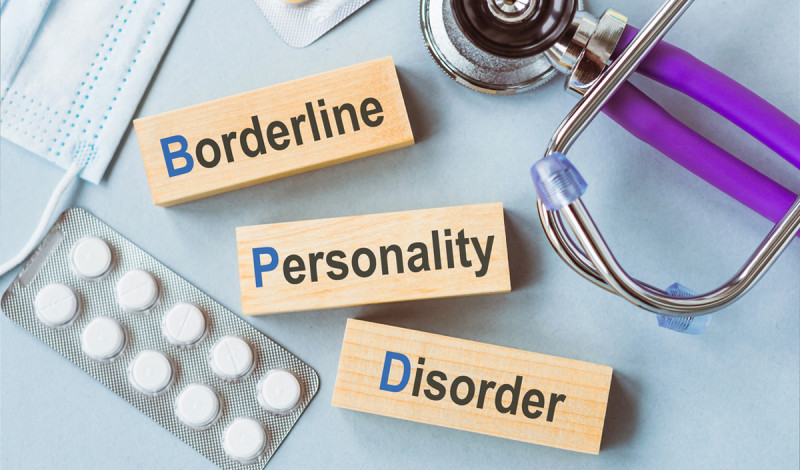 Symptome einer Borderline-Störung(c) Getty Images / Nastassia Samal
Symptome einer Borderline-Störung(c) Getty Images / Nastassia Samal
Ursachen von Borderline
Die Gründe für eine Borderline-Erkrankung liegen einerseits in genetischen Faktoren. Andererseits zeigen sich biografische Ereignisse in der Kindheit verantwortlich für Borderline. Unter anderem gehören dazu:
• Sexuelle Übergriffe
• körperliche und seelische Misshandlungen
• Missachtung und Vernachlässigung
In den meisten Fällen ist Borderline das Ergebnis einer Kombination aus neurobiologischen und psychologischen Gründen, gepaart mit Umwelteinflüssen. Experten schätzen, dass zwei bis drei Prozent der Bevölkerung an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden. Das Geschlecht spielt bei der Ausprägung keine Rolle. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Die Hilfesuchenden sind allerdings zu 70 Prozent weiblich.
Familiäre und genetische Faktoren
Birger Dulz, Präsident der Gesellschaft zur Erforschung und Therapie von Persönlichkeitsstörungen, sieht die Gründe für Borderline vor allem im familiären Umfeld. Dies soll eigentlich schützend agieren und dem Kind auch bei emotionalen Krisen Halt bieten. Fehlt der vertrauensvolle Umgang oder wird dem Kind gar nicht erst geglaubt, können Persönlichkeitsstörungen wie Borderline entstehen. Diese Erfahrungen haben negative Folgen für alle späteren Beziehungsgestaltungen der Betroffenen. Dem stimmt der Psychoanalytiker und Familientherapeut Manfred Cierpka zu. Kinder aus instabilen, vernachlässigenden Familien erlernen nur mangelhaft, mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen gesund umzugehen. Oftmals übernehmen sie aggressive Verhaltensweisen und entwickeln Persönlichkeitsstörungen.
Eine dauerhafte Borderline-Erkrankung beeinflusst zudem die Hirnstruktur. Untersuchungen in der Hirnforschung fanden bei Menschen mit Borderline eine verkleinerte Amygdala. In dieser Region verarbeitet das Gehirn Stress und Angst. Gleichzeitig weisen Borderline-Betroffene geringe Serotonin-Werte auf. Forscher vermuten in diesen beiden Faktoren die Ursache für die erhöhte Impulsivität und Aggression der Betroffenen.
Medizinische Behandlung von Borderline
Bei der Behandlung von Borderline helfen Psychotherapien, unterstützt von verschiedenen Medikamenten. Eine Psychotherapie hilft vor allem, wenn alle Faktoren und Symptome aufgedeckt und verstanden werden. Zunächst ist das Ziel der Therapie, den Patienten zu stabilisieren und möglichen Suizidgedanken sowie destruktiven Verhaltensmustern zu begegnen. Häufig kommt ein Zusammenspiel von Therapiemethoden zum Einsatz. Über einen Therapiezeitraum von ein bis drei Jahren besuchen Patienten oft sowohl Einzel- als auch Gruppentherapie. Neben Medikamenten stabilisiert auch die Option von Krisenintervention durch Telefonberatung. Je nach Ausprägung der Symptome wählen Psychotherapeuten die geeignete Therapieform aus. Dazu stehen ihnen verschiedene wissenschaftlich fundierte Optionen zur Verfügung.
Die dialektisch-behaviorale Therapie
Zu den gängigsten Methoden zählt die dialektisch behaviorale Therapie, eine spezielle Ausformung der kognitiven Verhaltenstherapie, konzipiert von der Therapeutin Marsha M. Linehan. Sie ist untergliedert in drei Therapiephasen Verhaltenskontrolle, Emotionale Bearbeitung und Lebensführung. In der ersten Phase üben Borderline-Patienten Methoden, um mehr innere Selbstkontrolle zu erlangen. Mit Hilfe der Therapeuten lernen Sie, ihre Gefühle besser einzuordnen, und einen verständnisvolleren Umgang mit sich selbst und ihren Mitmenschen. Patienten bauen ein stabilisiertes Verhalten und ein positiveres Selbstbild auf.
Die zweite Phase gibt den Patienten einen sicheren Raum, ihre negativen Lebenserfahrungen zu bearbeiten. In der dritten Phase entwerfen sie Konzepte für eine neue Lebensführung. Borderliner übertragen das Erlernte in den Alltag für eine dauerhafte Stabilisierung.
Schematherapie
Die Schematherapie hilft Borderlinern dabei, die negativen Erfahrungen der Kindheit aufzuarbeiten. Häufig sind wir uns kaum bewusst, wie stark die Erlebnisse der Kindheit auf unser gegenwärtiges Verhalten wirken. Die Erfahrungen legen sich schematisch über alle späteren Verhaltensmuster und die Gefühls- und Bedürfnisbearbeitung. Therapeuten begleiten ihre Patienten dabei, gezielte Erfahrungen zurück ins Bewusstsein zu holen. Die Schematherapie zielt auf besseres Selbstverständnis und Erfahrungsbewältigung ab. Damit sollen Patienten ihre negativen Denkmuster durchbrechen.
Mentalisierungsbasierte Therapie
In der mentalisierungsbasierten Therapie eignen sich Patienten neue Subjekt-Objekt-Differenzierungen an. Borderliner erlernen, das eigene Erleben und das der Mitmenschen besser zu verstehen und in rationale Zusammenhänge zu setzen. Das Ziel der mentalisierungsbasierten Therapie besteht in der Stärkung der Affektkontrolle. Dadurch handeln Betroffene weniger impulsiv und können stabilere Beziehungen eingehen.
Den gleichen Ausgangspunkt, also eine mangelnde Differenzierung, nimmt die übertragungsfokussierte Psychotherapie bzw. Transference Focused Therapy ein. Diese Therapieform konzentriert sich auf die Beziehungsarbeit zwischen Therapeut und Patient. Durch die Übertragung der einstmals unterfüllten kindlichen Bedürfnisse auf den Therapeuten kann der Patient den erlittenen Mangel an emotionalem Halt aufarbeiten.
 Einnahme von Medikamenten(c) Getty Images / nensuria
Einnahme von Medikamenten(c) Getty Images / nensuria
Welche Medikamente helfen bei Borderline?
Es gibt durchaus Medikamente, um einzelne Symptome der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu behandeln. Darunter fallen:
• Medikamente gegen Depressionen
• Medikamente gegen Angststörungen
• Stimmungsaufhellende Medikamente
Arzneien allein können aber keine Borderline-Erkrankung heilen, sondern eine Therapie nur unterstützen. Meist verschreiben Therapeuten genannte Mittel, um dem Patienten bei der Stabilisierung zu helfen.
Wie wirksam sind die Therapieformen?
Zur Wirksamkeit der Therapieformen gibt es nur wenige valide Daten. Die Dialektisch-Behaviorale Therapie und die Schematherapie sind im Vergleich zu anderen Formen am stärksten untersucht. Eine Metastudie der Christoph-Dornier-Stiftung Braunschweig aus dem Jahr 2004 ermittelte zwar eine relativ hohe durchschnittliche Gesamteffektstärke von 0,62 für die Dialektisch-Behaviorale Therapieform. Allerdings wurden nur wenige Studien verglichen. Das kann zu verzerrten Werten führen.
Ambulante und stationäre Therapien zeigen sich gleichermaßen wirksam. Fraglich bleibt, wie langanhaltend eine erfolgreiche Therapie im Alltag wirkt. Eine Studie zur Remissionsrate untersuchte, wie nachhaltig die Beschwerden nachließen. Darin kamen bei 30 Prozent der Borderline-Patienten die Symptome nach zwei Jahren wieder.
Borderline-Therapie und Krankenkassen
Die gesetzliche Krankenkasse trägt in den meisten Fällen eine Therapie bei Borderline-Erkrankung, wenn eine entsprechende Indikation vorliegt. Die Antragstellung übernimmt dabei häufig der Therapeut selbst. Dabei gelten die allgemeinen Bedingungen zur Kostenübernahme von Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie als Teil des Richtlinienverfahrenkatalogs der gesetzlichen Krankenkassen. Die dialektisch-behaviorale Therapie und die Schematherapie gelten noch als relativ junge Therapieformen. Daher sollte man sich vorab bei der eigenen Krankenkasse informieren, ob sie die Kosten dieser Verfahren trägt.